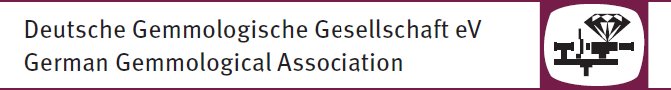Die klassische Farbe der Granate ist das Rot. Die ältesten Funde von Granatschmuck als Grabbeigaben datieren in die Bronzezeit vor über 5000 Jahren.
In der Antike entwickelte sich eine erste Blütezeit für Granatschmuck. Die Griechen nannten ihn anthrakas (nach anthrak = Kohle) und die Römer carbunculus (nach carbo = Kohle), weil die Steine im Sonnenlicht an glühende Kohle erinnerten. Bekannt sind Intaglios aus Granat in römischen Gold-, Bronze- oder Eisenringen, die bei zahlreichen Ausgrabungen römischer Siedlungen gefunden wurden.
Der römische Gelehrte Gaius Plinius Secundus verwendete die Bezeichnung carbunculus allgemein für durchsichtige rote Edelsteine und daraus wurde im Mittelalter „Karfunkel“.
Albertus Magnus (1193-1280) unterschied drei Arten des Karfunkels: Balagius (roter Spinell), Granatus (roter Granat) und Rubinus (Rubin). Somit findet sich der heutige Name Granat erstmals im 13. Jahrhundert in Albert Magnus` Buch über die Mineralien (De Mineralibus).
Der Name Granat leitet sich vom lateinischen granum = Korn ab.
Im Frühmittelalter, speziell der Merowinger Zeit, bis ins Spätmittelalter kam dem Granat eine wichtige Rolle in der Schmuckschaffung zu. Berühmt sind u.a. die Krone von Kertsch und die Adlerfibel der Frau von Oßmannstedt aus dem 5. Jahrhundert.
Die große Blütezeit der roten Granate begann im 17. Jahrhundert und dauerte bis ins frühe 20. Jahrhundert. Hiervon zeugen zahlreiche Gefäße, Gravuren und Schmuckstücke aus Granat in bedeutenden europäischen Schatzkammern und Sammlungen. Ein prominentes Schmuckstück ist der Orden des Goldenen Vlies im Grünen Gewölbe zu Dresden aus dem Jahr 1794, ein burgundischer Ritterorden mit den größten, angeblichen böhmischen Granaten. Typischer Granatschmuck stammt aus dem Biedermeier (1815-1870), aus Viktorianischer Zeit (1837-1901) und dem Jugendstiel (1890-1910).

Mineralogisch gehören die klassischen roten Granate der vollkommenen Mischkristallreihe Pyrop-Almandin an. Die reinen Endglieder Pyrop (Mg3Al2(SiO4)3) und Almandin (Fe3Al2(SiO4)3) sind selten und werden in Edelsteinqualität nicht angetroffen. Im Edelsteinhandel bezeichnet man magnesiumreiche Mischkristalle als Pyrop und eisenreiche als Almandin.
Der Magnesium-Aluminium-Granat Pyrop verdankt seine rote Farbe Spuren von Chrom („Chrom-Pyrop“) und/oder Eisen. Der Name stammt von Werner (1803) nach dem griechischen pyropos, was feueräugig oder feurig bedeutet. Weltweit berühmt wurden im 18. Jahrhundert die böhmischen Pyrope, deren Existenz schon im frühen Mittelalter bekannt war. Ein geregelter Abbau fand bereits im 16. und 17. Jahrhundert statt. Zentrum der Be- und Verarbeitung zum typischen, heute weitgehend touristisch bedeutenden böhmischen Granatschmuck ist die Stadt Turnov (das frühere Turnau) nordwestlich Prag. Die Rohkristalle sind meist klein mit einem Durchmesser bis 6 mm. Die durchschnittliche Größe geschliffener Steine liegt daher bei 1 bis 5 mm.
Pyrope aus den diamantführenden Kimberliten Südafrikas wurden aufgrund ihrer blutroten Farbe lange Zeit als „Kap-Rubine“ bezeichnet.
 Abb. 3: Almandin in Glimmerschiefer. Zillertal, Österreich. Bildbreite ca. 6 cm, Sammlung DGemG, Foto T. Stephan, DGemG.
Abb. 3: Almandin in Glimmerschiefer. Zillertal, Österreich. Bildbreite ca. 6 cm, Sammlung DGemG, Foto T. Stephan, DGemG.
Almandin ist der Eisen-Aluminium-Granat und verdankt seinen Namen Agricola (1546) nach der Stadt Alabanda am Fluss Mäander in der Türkei. Historische Bedeutung haben die Vorkommen im Gebiet des Zillertals und Ötztals in Österreich, die 1745 von einem Wilderer entdeckt wurden. Blütezeit der Zillertaler Granate war Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Verarbeitung zu dem traditionellen Granatschmuck (Trachtenschmuck), der heute noch regionale Bedeutung besitzt. Aufgrund der hohen Eisengehalte sind die in Glimmerschiefer vorkommenden Kristalle sehr dunkel und erscheinen meist schwarz und somit nicht transparent. Durch Klopfen oder Sägen in kleinere Dimensionen gebracht, erhalten sie Transparenz und eine tiefrote Farbe.
Ein wichtiger Lieferant von almandinreichen Granaten für die Schmuckherstellung ist seit Jahrhunderten bis heute Indien („Indischer Granat“). Bedeutende Vorkommen liegen in dem Bundesstaat Rajasthan mit seiner Hauptstadt Jaipur. Bei Hyderabad werden große Sterngranate angetroffen, die geschliffen mehrere Hundert Karat schwer sein können.
Anfang des 20. Jahrhunderts kamen erstmals lebhaft-rote Granate aus Ostafrika, dem heutigen Tansania, in den Handel. Die dunkleren Madagaskar-Granate folgten einige Jahre später.
Weitere kommerziell wichtige Vorkommen von roten Granaten befinden sich in Thailand und Mosambik.
Granate können gelegentlich gigantische Größen erreichen, die jedoch nicht schleifwürdig sind. Der größte je gefundene Granat stammt aus Norwegen. Der unregelmäßig geformte Granatblock besitzt einen Durchmesser von 2,3 Metern und ein Gewicht von 37,5 Tonnen. Diverse große, gut ausgebildete Granatkristalle sind in verschiedenen Museen weltweit ausgestellt und erreichen Größen von bis zu einem Meter.

Einer der größten bearbeiteten Granate ist eine Eikreation von Manfred Wild aus Kirschweiler, gestaltet nach Art der berühmten Fabergé-Kunstwerke. Das aus zwei Hälften bestehende, perfekt geschliffene Ei besteht aus rotem Granat aus Indien mit einem Gewicht von 5.696 ct Gewicht.
In der Medici Collection in Los Angeles, USA, befindet sich ein 3.956 ct. schwerer Sterngranat, der 2020 im Guinness Buch der Rekorde gelistet wurde.
Der bisher größte bekannte geschliffene Almandin ist ein Cabochon von 175 ct. im Smithsonian Institut in Washington, USA.
Historische Bedeutung besitzen u.a. der von Boethius de Boodt in seiner 1609 „Historia gemmarum“ erwähnte taubeneigroße Pyrop aus der Schatzkammer des Kaisers Rudolf II. sowie ein hühnereigroßer Pyrop (468,5 ct) in einem Orden des Goldenen Vlieses im Grünen Gewölbe in Dresden.
Autor
Dr. Ulrich Henn, DGemG
© 2024