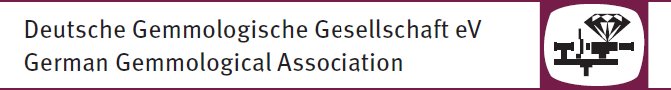Das aktuelle Themenheft
Edelsteine und ihre künstlichen Eigenschaftsveränderungen
ist für Mitglieder im Online-Archiv abrufbar.
Für alle Interessierten ist das Themenheft in Druckform bei der DGemG erhältlich:
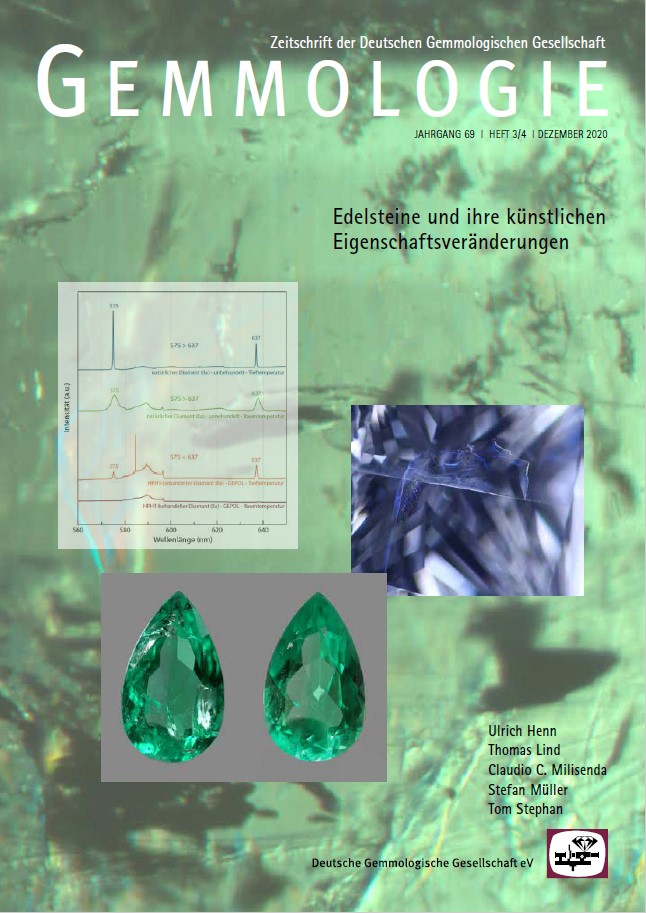
Vorwort zum aktuellen Heft 3/4 Dezember 2020
Die Verwendung von Edelsteinen zu Schmuck- und Repräsentationszwecken ist so alt wie die Kulturgeschichte der Menschheit. Genauso alt ist das fortwährende Bemühen um eine optimierte Bearbeitung des entsprechenden "Rohmaterials".
Einerseits betrifft dies die Verbesserung der Techniken zur mechanischen Bearbeitung und damit die Entwicklung der verschiedenen Edelsteinschliffe mit dem Ziel, die besonderen (insbesondere optischen) Eigenschaften der Edelsteine optimal zur Geltung zu bringen. Andererseits gilt dies auch für die Entwicklung von Methoden, mit denen die Eigenschaften des Rohmaterials selbst so verändert werden können, dass eine größere Ausbeute an schleifbarem Material möglich wird, bzw. der Anteil feiner Qualitäten am Gesamtangebot erhöht werden kann. Diese Methoden der künstlichen Eigenschaftsveränderungen von Edelsteinen werden unter dem Begriff der "Behandlung" zusammengefasst und von der Bearbeitung i.e.S. unterschieden.
Bereits aus der Antike sind Behandlungen von Edelsteinen bekannt. Neben dem hinreichend oft zitierten Ölen von Smaragden zur Verbesserung der Transparenz gibt es sowohl bei PLINIUS (um 77 n.Chr.) wie auch anderen antiken Quellen zahlreiche Hinweise auf verschiedene Edelsteinbehandlungen (eine ausführliche Übersicht über die antiken Methoden zur Farbbehandlung von Edelsteinen liefert HELM, 1978).
Über Jahrhunderte hinweg hat der Zufall Regie geführt. Das moderne naturwissenschaftliche Verständnis seit dem 19. Jahrhundert hat jedoch schließlich dazu geführt, einerseits die Wirkungsmechanismen der "traditionellen" Behandlungsmethoden zu verstehen und andererseits die Erkenntnisse der Materialwissenschaften gezielt einzusetzen, um neue Methoden zu entwickeln und bestehende zu optimieren.
Eine immer wieder gestellte Frage sowohl in den gemmologischen Ausbildungslehrgängen wie auch auf Vorträgen und Tagungen der DGemG oder in zahlreichen Diskussionen innerhalb der Schmuck- und Edelsteinbranche ist die Frage, ob und wie über die verschiedenen künstlichen Eigenschaftsveränderungen informiert werden muss. Hierzu haben sich in den vergangen Jahren einige international anerkannte Leitlinien herausgebildet, deren Grundlagen im ersten Kapitel des vorliegenden Sonderheftes der Zeitschrift "GEMMOLOGIE" dargestellt werden.
Der sich anschließende allgemeine Teil beschreibt die Entwicklung und Grundlagen der heute gängigen Behandlungsmethoden. Diesem Teil ist ein Literaturverzeichnis mit den wichtigsten Übersichtsartikeln zu diesem Thema angehängt.
Im darauffolgenden speziellen Teil werden zunächst die einzelnen Edelsteine bzw. Edelsteingruppen anhand ihrer jeweiligen chemischen Zusammensetzung, der Kristallsysteme, Farben (Varietäten), Farbursachen sowie der optischen Effekte beschrieben. Es folgt eine Zusammenfassung der bekannten künstlichen Eigenschaftsveränderungen.
Die Erkennungsmöglichkeiten sind kursiv gedruckt, wobei im Wesentlichen auf die Identifizierung mit Hilfe gemmologischer Standardmethoden Wert gelegt wird. Weitere aufwendigere analytische Verfahren sind jeweils genannt, werden aber nicht im Detail erläutert. Für weitere, diesbezügliche Informationen sei auf die wichtigsten Literaturzitate hingewiesen, die jeder Steinart folgen.
Einige Erkennungsmerkmale sind generell auf jede Behandlungsmethode anwendbar, wie z.B. eine Farbkonzentration in Rissen bei gefärbten Steinen. Diese Erkennungsmerkmale werden nur dann explizit beschrieben, wenn die jeweilige Behandlungsmethode auch von kommerzieller Bedeutung für die betreffende Steinart ist. Das Sonderheft "Edelsteine und ihre künstlichen Eigenschaftsveränderungen" bietet allen edelsteinkundlich interessierten Fachkreisen einen kompakten, aber umfassenden Überblick über dieses wichtige Teilgebiet der modernen Gemmologie und ist als Handbuch zum Nachschlagen und zur schnellen Orientierung gedacht.
HELM, D. (1978): Farben und Färben von Edelsteinen in der Antike.- Dissertation, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt am Main. Erschienen 2005 im Verlag Dr. Dieter Helm, Heppenheim.
Plinius, S. G. (2007): Naturkunde Buch 37: Steine, Edelsteine, Gemmen, Bernstein.- 2. Auflage.- Zürich, Düsseldorf, Artemis & Winkler.
Dr. Thomas Lind
Präsident
Deutsche Gemmologische Gesellschaft e.V.